Ehevertrag - wann ist er sittenwidrig
oder nichtig?
Später ist man immer schlauer - seien Sie es früher
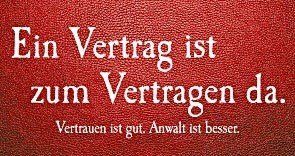
Im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle hat der Tatrichter zunächst zu prüfen, ob die Vereinbarung schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihr - und zwar losgelöst von der künftigen Entwicklung der Ehegatten und ihrer Lebensverhältnisse - wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu versagen ist, dass an ihre Stelle die gesetzlichen Regelungen treten (§ 138 Abs. 1 BGB ). Erforderlich ist dabei eine Gesamtwürdigung, die auf die individuellen Verhältnisse beim Vertragsschluss abstellt, insbesondere also auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, den geplanten oder bereits verwirklichten Zuschnitt der Ehe sowie auf die Auswirkungen auf die Ehegatten und etwaige Kinder. Subjektiv sind sodann die von den Ehegatten mit der Abrede verfolgten Zwecke sowie die sonstigen Beweggründe zu berücksichtigen, die die Ehegatten dazu bewogen haben, den Ehevertrag zu schließen. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit wird dabei regelmäßig nur in Betracht kommen, wenn durch den Vertrag Regelungen aus dem Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts ganz oder jedenfalls zu erheblichen Teilen abbedungen werden, ohne dass dieser Nachteil für den anderen Ehegatten durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch die besonderen Verhältnisse der Ehegatten, den von ihnen angestrebten oder gelebten Ehetyp oder durch sonstige gewichtige Belange des begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird. Das Gesetz kennt keinen unverzichtbaren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten, so dass auch aus dem objektiven Zusammenspiel einseitig belastender Regelungen nur dann auf die weiter erforderliche verwerfliche Gesinnung des begünstigten Ehegatten geschlossen werden kann, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich in dem unausgewogenen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz eines Ehegatten und damit eine Störung der subjektiven Vertragsparität widerspiegelt. Eine lediglich auf die Einseitigkeit der Lastenverteilung gegründete tatsächliche Vermutung für die subjektive Seite der Sittenwidrigkeit lässt sich bei familienrechtlichen Verträgen indes nicht aufstellen. Ein unausgewogener Vertragsinhalt mag zwar ein gewisses Indiz für eine unterlegene Verhandlungsposition des belasteten Ehegatten sein. Gleichwohl wird das Verdikt der Sittenwidrigkeit in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegenheit, hindeuten könnten (BGH vom 29. November 2023 - XII ZB 531/22 - FamRZ 2024, 512 Rn. 22 f. mwN).
BGH 28.05.2025 zur Gütertrennung in der Unternehmer-Ehe
Der BGH bestätigte die grundsätzliche Wirksamkeit von Eheverträgen mit vollständigem Zugewinnausschluss in Unternehmerehen. Gütertrennung gehört nicht zum Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts und ist bei berechtigten Interessen des Unternehmerschutzes zulässig.
Maßgebliche Kriterien:
- Keine Sittenwidrigkeit bei Aushandlung auf Augenhöhe
- Legitimes Interesse am Schutz des Betriebsvermögens vor existenzbedrohenden Zugriffen
- Ausreichende Kompensation durch anderweitige Regelungen (hier: nachehelicher Unterhalt)
Der Fall:
Die Eheleute hatten zuerst (2008) ein gemeinsames Kind bekommen, dann (2010) geheiratet und bekamen drei weitere Kinder (2012, 2014 und 2016). 2021 wurde die Scheidung eingereicht.
Bei Eheschließung war die Frau – studierte BWLerin – Geschäftsführerin einer GmbH. Der Mann war als Gesellschafter an verschiedenen Unternehmen seiner Familie beteiligt und dort teilweise auch als Geschäftsführer tätig. Die Gesellschaftsverträge sehen vor, dass jeder Gesellschafter mit dem Ehegatten Gütertrennung zu vereinbaren hat.
Deshalb errichtete das Paar vor der Hochzeit einen Ehevertrag. Darin wurde der Zugewinnausgleich ausgeschlossen (Gütertrennung vereinbart) und eine Regelung zum Unterhalt getroffen. Die Ehefrau war Tochter eines Anwaltsnotares, der sie bei den Verhandlungen vertrat.
Die Ehefrau ging nach der Scheidung zuerst zum OLG, dann zum BGH, weil sie die Unwirksamkeit des Ehevertrages geltend machte und Zugewinnausgleich haben wollte.
Das verneinten alle Instanzen.
Aus den Gründen:
aa) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, dass die von den Beteiligten getroffene Vereinbarung der Gütertrennung bei isolierter Betrachtung keinen Wirksamkeitsbedenken unterliegt, weil das Güterrecht nicht dem Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts zuzuordnen ist und der Zugewinnausgleich daher - auch wegen der gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen verschiedenen Güterstände - ehevertraglicher Gestaltung am weitesten zugänglich ist (vgl. Senatsbeschluss vom 29. November 2023 - XII ZB 531/22 - FamRZ 2024, 512 Rn. 19 mwN).
Dass die Beteiligten eine Unternehmerehe geführt haben, führt hier zu keiner anderen Beurteilung. Denn der Senat hat für Unternehmerehen bereits entschieden, dass ein vertraglicher Ausschluss des Zugewinnausgleichs auch dann nicht im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle zu korrigieren ist, wenn bereits bei Vertragsschluss absehbar gewesen ist, dass sich der andere Ehegatte ganz oder teilweise aus dem Erwerbsleben zurückziehen würde und ihm deshalb eine vorhersehbar nicht kompensierte Lücke in der Altersversorgung verbleibt. Vielmehr hat der Senat ein überwiegendes legitimes Interesse des erwerbstätigen Ehegatten anerkannt, das Vermögen seines selbständigen Erwerbsbetriebes durch die Vereinbarung der Gütertrennung einem möglicherweise existenzbedrohenden Zugriff seines Ehegatten im Scheidungsfall zu entziehen und damit nicht nur für sich, sondern auch für die Familie die Lebensgrundlage zu erhalten (vgl. Senatsbeschluss vom 15. März 2017 - XII ZB 109/16 - FamRZ 2017, 884 Rn. 36 mwN).
bb) Das Beschwerdegericht konnte dahinstehen lassen, ob die Regelungen des Ehevertrags insgesamt zu einer einseitigen Lastenverteilung - die ein gewisses Indiz für eine ungleiche Verhandlungsposition sein könnte - führen, weil es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde zu Recht eine subjektive Imparität verneint hat.
Rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht hierzu ausgeführt, es habe für die Antragsgegnerin keine Zwangslage begründet, dass der Antragsteller die Ehe nur unter der Bedingung eines Ehevertrags eingehen wollte, da sie nicht in besonderem Maße auf die Eheschließung angewiesen gewesen sei. Vielmehr sei sie bei Abschluss des Ehevertrags durch ihre berufliche Tätigkeit wirtschaftlich ausreichend abgesichert gewesen. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfahrung hätten auch gute Aussichten bestanden, nach ihrem Ausscheiden als Geschäftsführerin der GmbH eine vergleichbare Anstellung zu finden. Unabhängig von der Wirksamkeit der Klauseln in den Gesellschaftsverträgen, die den Antragsteller zur Vereinbarung der Gütertrennung verpflichten, könne nicht von einer subjektiven Imparität ausgegangen werden, weil dem Antragsteller keine Verwerflichkeit zur Last falle. Denn in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei ein überwiegendes legitimes Interesse an der Sicherung der Lebensgrundlage auch für die Familie selbst unabhängig von entsprechenden Güterstandsklauseln anerkannt. Auch der gegenseitige Erb- und Pflichtteilsverzicht begründe keine subjektive Imparität. Eine solche könne ebenso wenig daraus hergeleitet werden, dass die Antragsgegnerin bei den Vertragsverhandlungen durch ihren Vater anwaltlich vertreten war. Die Antragsgegnerin sei selbst in der Lage gewesen, die vertraglichen Regelungen in ihrer Bedeutung und ihren Auswirkungen intellektuell zu erfassen. Zudem seien Anhaltspunkte für die Annahme einer subjektiven Imparität durch etwaige Defizite im Zusammenhang mit der anwaltlichen Beratung durch den Vater weder ersichtlich noch substantiiert dargelegt. Dass die Antragsgegnerin durch den Abschluss des Ehevertrags "überrumpelt" worden sei, könne angesichts der Übermittlung der Eckpunkte des beabsichtigten Ehevertrags am 4. November 2010 und der sich anschließenden Vertragsverhandlungen bis zur notarielle Beurkundung des Ehevertrags am 3. Dezember 2010 ausgeschlossen werden.
Schließlich könne in der heutigen Zeit auch nicht mehr angenommen werden, dass ein Nichtzustandekommen der Heirat angesichts ihrer gesellschaftlichen Stellung eine Zwangslage für die Antragsgegnerin begründet habe, zumal sie zuvor bereits seit zwei Jahren mit dem Antragsteller in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit einem Kind gelebt habe.
(2) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde demgegenüber geltend, eine Störung der subjektiven Vertragsparität folge daraus, dass die Antragsgegnerin bei den Verhandlungen über den Ehevertrag durch ihren Vater, einen Rechtsanwalt und Notar, vertreten wurde. Vielmehr spricht dieser Umstand in erheblichem Maße gegen eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz des Antragstellers (vgl. Senatsbeschluss vom 29. Januar 2014 - XII ZB 303/13 - FamRZ 2014, 629 Rn. 44 mwN). Dabei kommt noch hinzu, dass der Antragsteller unwiderlegt vorgetragen hat, weder die Antragsgegnerin noch ihr Vater hätten auf ausdrückliche Nachfrage zu dem Vertretungsverhältnis zu Beginn der Verhandlungen über den Ehevertrag einen anderen Vertreter der Antragsgegnerin benannt.
Soweit die Antragsgegnerin das Bestehen einer Zwangslage für sich daraus herleiten will, dass der Antragsteller ohne die Unterzeichnung des Ehevertrags die Hochzeit abgesagt hätte und die Antragsgegnerin dadurch aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung einer besonderen Stigmatisierung anheimgefallen wäre, hat das Beschwerdegericht dieses Vorbringen in tatrichterlicher Verantwortung geprüft und für nicht durchgreifend erachtet. Hiergegen sind aus Rechtsgründen Bedenken nicht zu erheben (vgl. Senatsurteil vom 31. Oktober 2012 - XII ZR 129/10 - FamRZ 2013, 195 Rn. 26). Gleiches gilt für die von der Rechtsbeschwerde angestellte Erwägung, ein die subjektive Imparität begründender Druck folge daraus, dass mit der bei Nichtabschluss des Ehevertrags drohenden Absage der Hochzeit für sie ein gesellschaftlicher Skandal verbunden gewesen wäre. Das Beschwerdegericht weist insoweit darauf hin, dass angesichts der vergleichbaren sozialen Stellungen beider Beteiligten hierdurch keine Disparität mit unterschiedlichen Drucksituationen zum Nachteil der Antragsgegnerin begründet worden sei. Dies ist rechtsbeschwerderechtlich nicht zu beanstanden.
(4) Schließlich lässt sich - anders als die Rechtsbeschwerde meint - auch aus den Güterstandsklauseln in den Gesellschaftsverträgen des Antragstellers, die ihn zur Vereinbarung der Gütertrennung mit Ehegatten verpflichten, keine Zwangslage auf Seiten der Antragsgegnerin herleiten, ohne dass es für diese Beurteilung auf die Frage nach der Wirksamkeit dieser Klauseln ankäme. Es ist schon nicht erkennbar, inwieweit die Güterstandsklauseln den von der Antragsgegnerin für die imparitätische Verhandlungssituation angeführten inneren Konflikt - Abschluss des Ehevertrages mit den entsprechenden güterrechtlichen Regelungen oder Absage der Hochzeit - vertieft haben könnten. Im Übrigen spricht auch das Bemühen des Antragsgegners, den gesellschaftsvertraglichen Klauseln Rechnung zu tragen, unabhängig vom grundsätzlich legitimen Interesse des Unternehmer-Ehegatten an der Vereinbarung der Gütertrennung eher gegen dessen verwerfliche Gesinnung und damit gegen das Vorliegen des subjektiven Tatbestands von § 138 BGB .
c) Soweit das Beschwerdegericht eine Anpassung der Vereinbarung der Gütertrennung im Wege der Ausübungskontrolle abgelehnt hat, begegnet dies aus Rechtsgründen keinen Bedenken. Die Rechtsbeschwerde erinnert insoweit auch nichts.
Von einer weiteren Begründung der Entscheidung wird abgesehen, weil sie nicht geeignet wäre, zur Klärung von Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung, zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung beizutragen (§ 74 Abs. 7 FamFG ).
BGH, Beschluss vom 28.05.2025 - Aktenzeichen XII ZB 395/24
Ausschluss VA + Ausgleichszahlungen = wirksam
Der Fall:
Zehn Tage vor der Hochzeit 2011 beurkundete die Verlobten einen Ehevertrag.
Dabei schlossen sie den Zugewinnausgleich für den Fall einer Scheidung, den nachehelichen Unterhalt mit Ausnahme des Betreuungsunterhalts und den Versorgungsausgleich aus. Zum damaligen Zeitpunkt verdiente der Antragsgegner als Oberarzt monatlich ca. 8.500,00 € brutto und die Antragstellerin als Krankenschwester in Teilzeit (60 %) ca. 1.450,00 € brutto.
Im Scheidungsverfahren 2023 wollte die Ehefrau ihren Anteil an der höheren Altersversorgung des Mannes, was rd. 50.000 EUR wert gewesen wäre. Das begründete sie damit, dass sie wegen der Erziehung der beiden gemeinsamen Kinder sechs Jahre lang nicht erwerbstätig gewesen sei und danach nur Teilzeit gearbeitet habe. Bei Abschluss des Ehevertrages seien beide davon ausgegangen, dass sie neben der Erziehung von Kindern weiter wie bisher (60% Teilzeit) arbeiten werde. Sie habe der damaligen Erklärung des Mannes, dass der Vertrag lediglich zum Schutz seiner Existenz, nämlich zur Gründung einer eigenen Arztpraxis oder zum Einkauf in eine bestehende Praxis, dienen solle, vertraut. Über die tatsächlichen Auswirkungen, nämlich den Ausschluss des Versorgungsausgleichs, sei sie sich zu keinem Zeitpunkt bewusst gewesen. Der Vertrag habe nur den Zweck gehabt, die Frau wirtschaftlich zu binden und zu knebeln. Der Verzicht führe zu einer evident einseitigen, unzumutbaren Lastenverteilung.
Allerdings konnte der Mann vortragen, dass er ihr im Zeitraum von 2016 bis 2021 insgesamt 94.000 EUR überwiesen habe, die als Kompensation für den Wegfall des Erwerbseinkommens gemeint gewesen sei. Als Verwendungszweck wurde auf den regelmäßigen monatlichen Überweisungen "Ausgleich Gehalt" und "Ausgleich Gehalt und R+V" angegeben. Zusätzlich konnte sie über das Kindergeld verfügen. Alle Lebenshaltungskosten der Familie habe der Mann getragen – was die Frau bestritt. Der Mann meinte, die Frau habe über die notwendigen Mittel verfügt, eine private Altersvorsorge aufzubauen, und dadurch eine ausreichende Kompensation erhalten. Die Frau meint, das Geld sei komplett wieder in das Familienbudget geflossen, konnte das aber mit ihren Kontoauszügen nicht belegen.
AG und OLG stellten zunächst fest, dass die Frau sich nicht in einer unterlegenen Verhandlungsposition befunden habe, nämlich nicht in einer Zwangslage, einer sozialen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Antragsgegner oder einer intellektuellen Unterlegenheit.
Der durch den Ehevertrag vom 01.06.2011 vereinbarte Ausschluss des Versorgungsausgleichs hielt einer Inhaltskontrolle stand und ist nicht von vornherein nach § 138 Abs. 1 BGB sittenwidrig.
Aus den Gründen:
Ein Ausschluss des Versorgungsausgleichs ist nach § 138 Abs. 1 BGB schon für sich genommen unwirksam, wenn er dazu führt, dass ein Ehegatte aufgrund des bereits beim Vertragsschluss geplanten (oder zu diesem Zeitpunkt schon verwirklichten) Zuschnitts der Ehe über keine hinreichende Alterssicherung verfügt und dieses Ergebnis mit dem Gebot ehelicher Solidarität schlechthin unvereinbar erscheint (BGH FamRZ 2020, 1347 bis 1351).
Das Gesetz kennt keinen unverzichtbaren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten, so dass auch aus dem objektiven Zusammenspiel einseitig belastender Regelungen nur dann auf die weiter erforderliche verwerfliche Gesinnung des begünstigten Ehegatten geschlossen werden kann, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich in dem unausgewogenen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz dieses Ehegatten und damit eine Störung der subjektiven Vertragsparität widerspiegelt (BGH a. a. O.). Eine lediglich auf die Einseitigkeit der Lastenverteilung gegründete tatsächliche Vermutung für die subjektive Seite der Sittenwidrigkeit lässt sich bei familienrechtlichen Verträgen nicht aufstellen (BGH a. a. O.). Ein unausgewogener Vertragsinhalt mag zwar ein gewisses Indiz für eine unterlegene Verhandlungsposition des belasteten Ehegatten sein (BGH a. a. O.). Gleichwohl wird das Verdikt der Sittenwidrigkeit in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn sonst außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegenheit, hindeuten könnten (BGH a. a. O.).
Der Ausschluss des Versorgungsausgleichs hält auch einer Ausübungskontrolle stand.
aa) Soweit die Regelungen eines Ehevertrags - wie hier - der Wirksamkeitskontrolle standhalten, muss der Richter im Rahmen einer Ausübungskontrolle prüfen, ob und inwieweit es einem Ehegatten nach Treu und Glauben unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB ) verwehrt ist, sich auf eine ihn begünstigende Regelung zu berufen. Entscheidend ist insofern, ob sich im Zeitpunkt des Scheiterns der Ehe aus dem vereinbarten Ausschluss der Scheidungsfolge eine evident einseitige, unzumutbare Lastenverteilung ergibt (BGH a. a. O.). Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die tatsächliche einvernehmliche Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse von der ursprünglichen, dem Vertrag zugrundeliegenden Lebensplanung grundlegend abweicht (BGH NJW 2005, 139 bis 141).
Allerdings lässt es nicht jede Abweichung der späteren tatsächlichen Lebensverhältnisse von der ursprünglich zugrundegelegten Lebensplanung als unzumutbar erscheinen, am ehevertraglichen Ausschluss von Scheidungsfolgen festzuhalten (BGH a. a. O.). Die Frage, ob eine einseitige Lastenverteilung nach Treu und Glauben hinnehmbar ist, kann vielmehr nur unter Berücksichtigung der Rangordnung der Scheidungsfolgen beantwortet werden: Je höherrangig die vertraglich ausgeschlossene und nunmehr dennoch geltend gemachte Scheidungsfolge ist, um so schwerwiegender müssen die Gründe sein, die - unter Berücksichtigung des inzwischen einvernehmlich verwirklichten tatsächlichen Ehezuschnitts - für ihren Ausschluss sprechen (BGH a. a. O.).
Ein wirksam vereinbarter - völliger oder teilweiser - Ausschluss des Versorgungsausgleichs hält deshalb einer Ausübungskontrolle am Maßstab des § 242 BGB dann nicht stand, wenn er dazu führt, dass ein Ehegatte aufgrund einvernehmlicher Änderung der gemeinsamen Lebensumstände über keine hinreichende Alterssicherung verfügt und dieses Ergebnis mit dem Gebot ehelicher Solidarität schlechthin unvereinbar erscheint (BGH a. a. O.). Das kann namentlich dann der Fall sein, wenn sich ein Ehegatte einvernehmlich der Betreuung der gemeinsamen Kinder gewidmet und deshalb auf eine versorgungsbegründende Erwerbstätigkeit in der Ehe verzichtet hat (BGH a. a. O.). Das in diesem Verzicht liegende Risiko verdichtet sich zu einem Nachteil, den der Versorgungsausgleich gerade auf beide Ehegatten gleichmäßig verteilen will und der ohne Kompensation nicht einem Ehegatten allein angelastet werden kann, wenn die Ehe scheitert (BGH a. a. O.).
Bei Vertragsschluss war geplant, dass die Antragstellerin auch nach der Geburt von Kindern weiter berufstätig sein soll. Diesbezüglich ist es zu einer grundlegenden Abweichung der tatsächlichen Lebensverhältnisse gekommen, da die Antragstellerin ab Mai 2015, nämlich ab Geburt des ersten Kindes, bis zur Trennung im Juli 2021 nicht mehr erwerbstätig war, sondern die gemeinsamen Kinder betreut hat. Dafür, dass diese Lebensgestaltung nicht einvernehmlich war, gibt es keine Anhaltspunkte. Die Antragstellerin hat dadurch einen Nachteil erlitten, weil sie insoweit zugunsten der Kindesbetreuung auf eine versorgungsbegründende Erwerbstätigkeit verzichtet hat. Dieser Nachteil kann nicht der Antragstellerin allein angelastet werden. bb) Die Antragstellerin hat jedoch durch die unstreitigen Zahlungen des Antragsgegners an sie im Zeitraum von 2016 bis 2021 in Höhe von zumindest 94.000,00 € eine ausreichende Kompensation für die erlittenen Nachteile erhalten.
Diese Zahlungen haben zum Aufbau einer privaten Altersversorgung der Antragstellerin bei der R+V Lebensversicherung AG mit einem Ehezeitanteil von 17.862,84 € (Kapitalwert) geführt. Unter Berücksichtigung der Versorgungsanrechte des Antragsgegners, die bei Durchführung des Versorgungsausgleichs zu einem Ausgleich nach Kapitalwerten in Höhe von 50.040,01 € zugunsten der Antragstellerin führen würden, ist zunächst festzustellen, dass das Anrecht der Antragstellerin bei der R+V Lebensversicherung AG für sich genommen keine ausreichende Kompensation für den Ausschluss des Versorgungsausgleichs darstellt.
Die Antragstellerin hätte mit den Zahlungen des Antragsgegners allerdings eine weitere erhebliche Altersversorgung - neben derjenigen bei R+V - aufbauen können.
Weil der Ehemann ihr die 94.000 EUR gezahlt hatte, war sie ausreichend kompensiert und der Verzicht war wirksam.
OLG Stuttgart, Beschluss vom 26.06.2025 - Aktenzeichen 11 UF 194/24
Totalverzicht + mangelnde Deutschkenntnisse
= dennoch wirksam
Der Fall:
Im Januar 1999 war die Hochzeit, im April 1999 der Notartermin, es wurde ein sog. Totalverzicht vereinbart (Unterhalt, Zugewinn und Versorgungsausgleich). Am Ende der Ehe waren beide Eheleute Unternehmer.
Der Ehemann behauptete die Unwirksamkeit des Ehevertrages und begehrte daher im Scheidungsverbund in der Folgesache GÜ Auskunft zum Endvermögen der Ehefrau.
Diesen Auskunftsanspruch lehnte das AG durch Teilbeschluss ab, das OLG Karlsruhe bestätigte.
Dafür prüften die Gerichte inzident die Wirksamkeit des Ehevertrages. Der Ausschluss des Zugewinnausgleichs für sich sei nicht sittenwidrig, weil das Güterrecht nicht zum Kernbereich der Scheidungsfolgen gehöre und einer individuellen vertraglichen Regelung am weitesten zugänglich sei. Auch die Gesamtschau des Vertrages führe nicht zu einem anderen Ergebnis. Es fehle jedenfalls an der für eine Sittenwidrigkeit erforderlichen einseitigen Lastenverteilung. Schließlich hätte es auch keine wesentliche Abweichung der tatsächlich gelebten ehelichen Lebensverhältnisse im Vergleich zur Vorstellung der Beteiligten beim Vertragsschluss gegeben.
Aus den Gründen:
Das Amtsgericht hat im Wege des Teilbeschlusses ausschließlich über die Auskunftsstufe in der Folgesache Güterrecht entschieden. Eine unzulässige Teilentscheidung dürfte hierin nicht zu sehen sein.
Eine unzulässige Teilentscheidung wird in Teilen der Rechtsprechung angenommen, wenn lediglich der Auskunftsanspruch eines Stufenantrags im Verbund abgewiesen wird trotz Annahme eines der Auskunft entgegenstehenden wirksamen Ehevertrages, der sich auch auf die Bezifferung auswirkt (OLG Celle, Beschluss vom 14. Dezember 2022 - 15 UF 137/21 - Rn. 57). Dies wird damit begründet, dass wenn die Rechtsgrundlage des Leistungsanspruchs, dessen späterer Bezifferung der im Wege des Stufenantrags zunächst zur Entscheidung gestellte Auskunftsanspruch dienen soll, streitig ist, mit der Entscheidung auf der Auskunftsstufe nicht zugleich eine rechtskräftige Feststellung zum streitigen Grund des Leistungsanspruchs erfolgt, weshalb die Möglichkeit einer abweichenden Beurteilung auf nachfolgenden Stufen bestehe. Eine Teilentscheidung dürfe jedoch nur erlassen werden, wenn die Gefahr widersprechender Entscheidungen ausgeschlossen sei (OLG Celle a.a.O.).
Dieser Auffassung dürfte jedoch nicht zu folgen sein. Zutreffend ist, dass eine rechtskräftige Feststellung der Wirksamkeit des Ehevertrages durch die Auskunftsentscheidung nicht ergeht und nach ständiger Rechtsprechung des BGH auch bei grundsätzlicher Teilbarkeit des Streitgegenstands ein Teilurteil (§ 301 ZPO ) nur ergehen darf, wenn die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen - auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht - ausgeschlossen ist. Eine Gefahr sich widersprechender Entscheidungen ist namentlich dann gegeben, wenn in einem Teilurteil eine Frage entschieden wird, die sich dem Gericht im weiteren Verfahren über andere Ansprüche oder Anspruchsteile noch einmal stellt oder stellen kann. Das gilt auch insoweit, als es um die Möglichkeit einer unterschiedlichen Beurteilung von bloßen Urteilselementen geht, die nicht in Rechtskraft erwachsen (BGH, Urteil vom 1. Juli 2020 - VIII ZR 323/18 -, Rn. 18, juris m.w.N.).
In Fällen, in denen Ansprüche im Wege eines Stufenantrags verfolgt werden, ist es rechtlich allerdings nicht ausgeschlossen, dass die maßgeblichen Vorfragen im weiteren Verfahren über den Zahlungsanspruch anders als im Teilbeschluss beurteilt werden. Diese Gefahr einander widersprechender Teilbeschlüsse und damit eine Ausnahme vom Verbot der Widerspruchsfreiheit über die auf den einzelnen Stufen eines Stufenantrags geltend gemachten Ansprüche wird hingenommen, weil andernfalls in solchen Fällen über die Stufenanträge - oder auch diesen gegebenenfalls gegenüberstehenden Wideranträgen - im Ergebnis nicht entschieden werden könnte (vgl. BGH, Urteil vom 29. März 2011 - VI ZR 117/10 -, Rn. 17, juris, m.w.N.; Feskorn in Zöller, 35. Aufl. § 301 ZPO Rn 16).
So entspricht es höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass bei Vorliegen eines Ehevertrages die Verpflichtung zu einer Auskunftserteilung wegen Unwirksamkeit des Ehevertrages per Teilbeschluss ergehen kann, obwohl auch in diesem Fall die Gefahr besteht, dass in der nachfolgenden Bezifferungsstufe die Wirksamkeit des Ehevertrages anders beurteilt wird (vgl. etwa BGH, Beschluss vom 17. Januar 2018 - XII ZB 20/17 - insbes. Rn. 25, juris, m.w.N.).
Zwar hätte das Amtsgericht, seiner Auffassung zur Wirksamkeit der ehevertraglichen Vereinbarung folgend, bereits die Scheidung aussprechen, die Anträge in der Folgesache Zugewinn insgesamt abweisen und einen Versorgungsausgleich nicht stattfinden lassen können. Dass es entsprechend der ausdrücklichen Anträge der Beteiligten vorab ausschließlich über die Auskunftsstufe in der Folgesache Zugewinn entschieden hat, dürfte gemäß den voranstehenden Ausführungen jedoch nicht zur Unzulässigkeit seiner Entscheidung führen.
b.
Der am 12.04.1999 geschlossene Ehevertrag dürfte wirksam sein mit der Folge, dass das Amtsgericht den Auskunftsantrag des Antragsgegners zum Zugewinnausgleich zu Recht abgewiesen hat.
aa.
Zur Prüfung der Frage, ob ein Ehevertrag Geltung beanspruchen kann, ist zunächst im Wege der tatrichterlichen Einzelprüfung im Rahmen einer Wirksamkeitskontrolle zu prüfen, ob die Vereinbarung schon im Zeitpunkt des Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihr - und zwar losgelöst von der künftigen Entwicklung der Ehegatten und ihren Lebensverhältnissen - wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu versagen ist, dass an ihre Stelle nach § 138 Abs. 1 BGB die gesetzlichen Regelungen treten (BGH, Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02, Rn. 45, juris). Erforderlich ist dabei eine Gesamtwürdigung, die auf die individuellen Verhältnisse beim Vertragsschluss abstellt, insbesondere also auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, den geplanten oder bereits verwirklichten Zuschnitt der Ehe sowie auf die Auswirkungen auf die Ehegatten und etwaige Kinder. Subjektiv sind sodann die von den Ehegatten mit der Abrede verfolgten Zwecke sowie die sonstigen Beweggründe zu berücksichtigen, die die Ehegatten dazu bewogen haben, den Ehevertrag zu schließen. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit wird dabei regelmäßig nur in Betracht kommen, wenn durch den Vertrag Regelungen aus dem Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts ganz oder jedenfalls zu erheblichen Teilen abbedungen werden, ohne dass dieser Nachteil für den anderen Ehegatten durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch die besonderen Verhältnisse der Ehegatten, den von ihnen angestrebten oder gelebten Ehetyp oder durch sonstige gewichtige Belange des begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird (BGH, Beschluss vom 29. November 2023 - XII ZB 531/22 -, Rn. 23, juris).
Gesehen werden muss hierbei, dass die gesetzlichen Regelungen grundsätzlich der vertraglichen Disposition der Ehegatten unterliegen. Artikel 6 GG verbürgt für beide Ehegatten das Recht, ihre eheliche Lebensgemeinschaft eigenverantwortlich und frei von gesetzlichen Vorgaben entsprechend ihrer individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse zu gestalten. Die auf die Scheidungsfolgen bezogene Vertragsfreiheit ist insoweit eine notwendige Ergänzung des verbürgten Rechts und entspricht dem legitimen Bedürfnis, Abweichungen von den gesetzlich geregelten Scheidungsfolgen zu vereinbaren, die zu dem individuellen Ehebild der Ehegatten besser passen. Die grundsätzliche Disponibilität der Scheidungsfolgen darf indessen nicht dazu führen, dass der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen durch vertragliche Vereinbarungen beliebig unterlaufen werden kann. Das wäre der Fall, wenn eine evident einseitige und durch individuelle Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte Lastenverteilung entstünde, die hinzunehmen für den belastenden Ehegatten bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe unzumutbar erscheint. Dies bedarf um so genauerer Prüfung, je unmittelbarer die vertragliche Abbedingung gesetzlicher Regelungen in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingreift. Zu diesem Kernbereich gehört insbesondere der Betreuungsunterhalt, der Alters- und Krankheitsunterhalt aber auch der Versorgungsausgleich (BGH, Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02, Rn. 40-42, juris). Das Gesetz kennt allerdings keinen unverzichtbaren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten, so dass auch aus dem objektiven Zusammenspiel einseitig belastender Regelungen nur dann auf die weiter erforderliche verwerfliche Gesinnung des begünstigten Ehegatten geschlossen werden kann, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich in dem unausgewogenen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz eines Ehegatten und damit eine Störung der subjektiven Vertragsparität widerspiegelt. Eine lediglich auf die Einseitigkeit der Lastenverteilung gegründete tatsächliche Vermutung für die subjektive Seite der Sittenwidrigkeit lässt sich bei familienrechtlichen Verträgen indes nicht aufstellen. Ein unausgewogener Vertragsinhalt mag zwar ein gewisses Indiz für eine unterlegene Verhandlungsposition des belasteten Ehegatten sein. Gleichwohl wird das Verdikt der Sittenwidrigkeit in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität, insbesondere infolge der Ausnutzung einer Zwangslage, sozialer oder wirtschaftlicher Abhängigkeit oder intellektueller Unterlegenheit, hindeuten könnten (BGH, Beschluss vom 29. November 2023 - XII ZB 531/22 -, Rn. 23, juris).
bb.
Nach diesen Maßstäben dürfte die Wirksamkeit des Ehevertrages der Beteiligten nicht - wegen der von dem Antragsgegner behaupteten sittenwidrigen Benachteiligung zu seinen Lasten - zu verneinen sein.
(1)
Der Ausschluss des Zugewinnausgleichs an sich führt nicht zur Unwirksamkeit der Vereinbarung. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH erweist sich der Zugewinnausgleich einer ehevertraglichen Disposition am weitesten zugänglich. Schon im Hinblick auf die nachrangige Bedeutung des Zugewinnausgleichs im System des Scheidungsfolgenrechts wird ein isolierter Ausschluss des gesetzlichen Güterstands regelmäßig nicht sittenwidrig sein (BGH, Urteil vom 21. November 2012 - XII ZR 48/11 -, Rn. 17, juris). Bei einem unternehmerisch tätigen Ehegatten besteht zudem ein legitimes Interesse, das Vermögen seines selbständigen Erwerbsbetriebes durch die Vereinbarung der Gütertrennung einem möglicherweise existenzbedrohenden Zugriff seines Ehegatten im Scheidungsfall zu entziehen und damit nicht nur für sich, sondern auch für die Familie die Lebensgrundlage zu erhalte (OLG Hamm, Beschluss vom 18. Oktober 2023 - II-9 UF 166/22 -, Rn. 75, juris).
In dem Ehevertrag wurde neben dem Zugewinnausgleich auch auf den Versorgungsausgleich verzichtet. Insoweit ist bereits nicht ersichtlich, dass hierdurch bei Vertragsabschluss angesichts der mutmaßlichen zukünftigen Entwicklung in der Ehe für den Antragsgegner Nachteile zu erwarten waren. Nach Darstellung des Antragsgegners war die Antragstellerin als Unternehmerin tätig, während bei ihm der weitere Berufsweg noch unklar gewesen sei. Als selbständige Unternehmerin erwirtschaftet die Antragstellerin keine Anrechte in der gesetzlichen Rentenversicherung, weshalb bei Unternehmerehen der Verzicht auf den Versorgungsausgleich regelmäßig positiv für den Nichtunternehmer ist (vgl. BGH, Beschluss vom 15. März 2017 - XII ZB 109/16 -, Rn. 34, juris; OLG Hamm a.a.O., Rn. 72, beck-online; Born UnterhaltsR-HdB/Born, 66. EL November 2024, 15. Kap. Rn. 183, beck-online; Christof Münch in: Münch, Die Unternehmerehe, § 2 Rechtsfolgen der Ehe, Rn. 10). Dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses davon ausgegangen wurde, die Antragstellerin würde aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit im Versorgungsausgleich höherwertige auszugleichende Anrechte erwirtschaften, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Soweit in dem Ehevertrag auch auf nachehelichen Unterhalt verzichtet wurde, dürfte auch dies nicht zur Unwirksamkeit der vertraglichen Regelungen führen. Wie von dem Antragsgegner selbst vorgetragen, war zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch offen, welchen beruflichen Weg er einschlagen werde. Dabei ist - auch von der Antragsgegnerseite - nicht vorgetragen, dass damit gerechnet worden wäre, dass er bei einer Trennung der Eheleute wegen der Betreuung der Kinder unterhaltsbedürftig werden würde. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am 12.04.1999 war die alleinige Tochter der Antragstellerin 11 Jahre alt, ersichtlich müsste sich nach einer etwaigen Trennung die Antragstellerin um diese kümmern. Der gemeinsame Sohn kam am 15.12.1999 zur Welt. Dass die Beteiligten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses acht Monate zuvor von einer Betreuung eines gemeinsamen Kindes durch den Antragsgegner ausgegangen wären, die dessen berufliches Fortkommen behindern würde, ist nicht vorgetragen. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass die angenommenen finanziellen Verhältnisse sich bei Ausschluss des Unterhalts als evident einseitig darstellen würden. Bei Vertragsschluss wurden die gesamten Vermögensverhältnisse - mithin einschließlich der unternehmerischen Beteiligung - mit 40.000 DM angegeben. Der studierte Antragsgegner hatte gute Aussichten, beruflich erfolgreich einzusteigen. Wie von ihm selbst betont, war nicht abzusehen, wie sich dies entwickeln werde. Dem folgend kann zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch nicht davon ausgegangen worden sein, dass die getroffene Vereinbarung den Antragsgegner einseitig belasten werde. Die Entwicklung war vielmehr offen.
Insgesamt dürfte daher der wechselseitige Verzicht auf die gesetzlichen Scheidungsfolgen durch die beiderseitigen Verhältnisse bei Eingehung der Ehe wie auch das von ihnen angestrebte Ehemodell gerechtfertigt sein.
Die Umstände des Zusammenkommens des Vertrages führen vor dem Hintergrund der geschilderten Lastenverteilung ebenfalls nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages wegen sittenwidriger Benachteiligung des Antragsgegners. Der Antragsgegner hat keine Dispositionen vorgetragen, die ihn bei Abschluss des Vertrages in eine Zwangslage versetzt hätten, die von der Antragstellerin ausgenutzt worden wären. Insbesondere wurde nicht etwa die Eingehung der Ehe selbst von dem Abschluss des Ehevertrages abhängig gemacht, sondern dieser erst einige Monate danach abgeschlossen.
Soweit der Antragsgegner behauptet, wegen sprachlicher Einschränkungen und fehlender Erläuterungen und Beratungen den Inhalt des Vertrages nicht verstanden zu haben, steht dies im Widerspruch zu den Festhaltungen im Notarvertrag zu seinen deutschen Sprachkenntnissen und über die erfolgten Belehrungen. Dass der Antragsgegner, der sein Abitur auf Deutsch absolvierte und auf Englisch studierte, sprachlich oder intellektuell nicht in der Lage gewesen wäre, den Inhalt der Vereinbarung zu erfassen, ist nicht erkennbar. Sollte er den Vertrag gleichwohl ohne ausreichendes Verständnis des beurkundeten Inhalts abgeschlossen haben, dürfte er sich auf ein derart leichtfertiges Verhalten in eigener Sache im Nachhinein nicht mit Erfolg berufen können, da den dargelegten Gesamtumständen nach auch dann der Vertragsabschluss nicht auf dem Ausnutzen einer ungleichen Verhandlungsposition durch die Antragstellerin beruht haben würde.
Die im Rahmen der Ausübungskontrolle nach § 242 BGB zu berücksichtigende tatsächliche Entwicklung in der Ehezeit dürfte ebenfalls nicht die Sittenwidrigkeit der notariellen Vereinbarung begründen. Insoweit ist festzuhalten, dass beide Beteiligte unternehmerisch tätig wurden und die Unternehmungen miteinander verschmolzen wurden, wobei beide an der entstehenden Gesellschaft zu 50 % beteiligt wurden. Beide bezogen das identische Geschäftsführergehalt und hatten nach den erstinstanzlichen Angaben zum Verfahrenswert auch bei Einleitung des Scheidungsverfahrens ein auskömmliches Einkommen in gleicher Höhe.
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 06.05.2025 - Aktenzeichen 20 UF 4/25
Auskunftsanspruch bei modifiziertem Zugewinn
Der Fall:
Die Eheleute hatten 2003 geheiratet und 2017 mit notariellem Ehevertrag ihren Güterstand modifiziert. Der Zugewinnausgleich sollte nicht stattfinden hinsichtlich der "jetzigen und künftigen" Gesellschaftsanteile des Ehemannes an einer GmbH und einer UG. Die Herausnahme aus dem Zugewinnausgleich erstreckt sich dabei auch auf Surrogate für die vorgenannten Vermögensgegenstände: "Erfolgen Verwendungen oder Investitionen auf zugewinnausgleichsfreies Vermögen des Ehemannes unter Verwendung von Mitteln aus zugewinnausgleichspflichtigem Vermögen des Ehemannes, werden diese Verwendungen oder Investitionen dem Endvermögen des Ehemannes mit dem Wert zum Zeitpunkt der Vornahme der Verwendung oder Investition und unter Ausgleich des Kaufkraftschwundes hinzugerechnet und unterliegen deshalb dem Zugewinnausgleich."
2019 hatte der Ehemann die Gesellschaftsanteile verkauft und dafür Eigentumswohnungen und Kapitalanlagen erworben.
In seiner güterrechtlichen Auskunft hatte er diese Vermögensbestandteile nicht mit aufgeführt.
Neben der Vervollständigung seines Vermögensverzeichnisses verlangte die Ehefrau Auskunft über die Herkunft der Mittel, mit welchen die Eigentumswohnungen in München und Prien am Chiemsee erworben wurden, um prüfen zu können, ob diese Wohnungen als Surrogat vom Zugewinn ausgenommen seien.
Das Amtsgericht hatte den Antrag abgelehnt und die Frau darauf verwiesen, dass sie die Unvollständigkeit des Verzeichnisses auf der Stufe der „eidesstattlichen Versicherung“ geltend machen müsse.
Anders das OLG München in einem Hinweisbeschluss:
Der Ehemann habe seine Auskunftsverpflichtung durch die bereits erteilte Auskunft nicht erfüllt hat. Es seien Angaben erforderlich, welche Surrogate der Veräußerung der Gesellschaftsanteile an der GmbH gefolgt sind und aus welchen Mitteln die beiden Eigentumswohnungen in München und Prien am Chiemsee erworben wurden. Die Ehefrau habe einen Anspruch darauf, in die Lage versetzt zu werden, zu prüfen, ob es sich um ein aus ausgenommenen Vermögenspositionen finanziertes Surrogat handelt und ob das Vermögensverzeichnis vollständig abgegeben wurde.
Der Ehemann habe auch Angaben zu den von der Antragsgegnerin vorgebrachten Kapitalrücklagen in den Jahren 2014 bis 2016 an der GmbH zu tätigen, damit für die Ehefrau wiederum nachvollziehbar ist, ob es sich um Mittel handelte, die aus zugewinnausgleichspflichtigem Vermögen des Ehemanns stammten.
Diese Rechtsauffassung, die der des OLG Celle, BeckRS 2024, 21621 entspricht, steht auch nicht im Widerspruch zu der des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main im Hinweisbeschluss vom 13.1.2020, NJW 2020, 1527 . Das OLG Frankfurt hat dabei darauf hingewiesen, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn sich ein Ehegatte eine Regelung zur Herausnahme von Betriebsvermögen aus dem Zugewinnausgleich zulässigerweise zunutze macht und er durch Schaffung von gewillkürtem Betriebsvermögen vormaliges Privatvermögen dem Zugewinnausgleich entzieht. Hinsichtlich derartiger "Vermögensverschiebungen"besteht in diesem Fall kein Auskunftsanspruch des anderen Ehegatten.
OLG München, Beschluss vom 30.01.2025 - Aktenzeichen 16 UF 577/24 e
VA-Verzicht + mangelnde Deutschkenntnisse
= dennoch wirksam
Der Fall:
Wenige Tage vor der Heirat im Jahr 2002 hatten die Verlobten notariell Gütertrennung vereinbart und auf Versorgungsausgleich und Nachscheidungsunterhalt verzichtet. 2007 und 2012 wurden Kinder geboren, 2019 erfolgte die Trennung.
Die nicht-deutsche Ehefrau machte Unterlegenheit bei Vertragsschluss geltend und wollte zumindest den Versorgungsausgleich.
Hierzu trug sie vor, sie sei ohne jedwede Deutschkenntnisse im Oktober 2001 mit einem Visum als "Au-pair" nach Deutschland eingereist. Zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung sei sie der deutschen Sprache nicht mächtig gewesen. Insbesondere sei sie nicht in der Lage gewesen, juristisch formulierte Texte zu erfassen. Im Sommer 2002 habe sie einen ersten Deutschkurs am Goethe Institut absolviert und den heutigen Grad A1 erworben. Erst im Sommer 2003 habe sie einen weiteren Sprachkurs belegt und das heutige "Goethe Zertifikat B2" erlangt. Erst mit dieser Qualifikation sei sie in der Lage gewesen, die Hauptinhalte von komplexen Texten sowie von konkreten und abstrakten Themen zu verstehen.
Der Ehevertrag sei von ihrem Schwiegervater in Auftrag gegeben worden. Hinsichtlich seines Inhalts habe sie der Familie des Antragsgegners vertraut. Weder habe ihr vorab ein Entwurf vorgelegen, noch habe sie eine Kopie erhalten. Sie sei lediglich zum Beurkundungstermin mitgenommen und dort nicht nach ihren deutschen Sprachfähigkeiten gefragt worden. Weder habe ihr dort ein Dolmetscher zur Verfügung gestanden, noch sei der Vertragstext in ihre Muttersprache übersetzt worden.
Weder habe sie damals über Vermögen verfügt, noch sei ihr die Bedeutung des Versorgungsausgleichs klar gewesen.
Der Ehemann trug vor, die Deutschkenntnisse der Ehefrau seien ausreichend gewesen, davon habe sich auch der Notar einen Eindruck verschafft. Außerdem habe es vorher mehrere gemeinsame Besprechungen des Inhaltes bei einer Rechtsanwältin gegeben. Diese Anwältin war vom Amtsgericht als Zeugin gehört worden, die konnte sich aber nicht mehr erinnern, und da sie nur eine Erstberatungspauschale angerechnet hatte, ließen sich „mehrere Besprechungen“ nicht beweisen.
Das Amtsgericht gab der Frau Recht, dass sie nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland nicht in der Lage gewesen sein könne, den Vertrag zu verstehen. Auf den Erwerb von Zertifikaten in der deutschen Sprache komme es insoweit nicht an. Bei dem notariellen Vertrag handele es sich weder um "Small Talk" noch um Umgangssprache, welche von sprachgewandten Personen leicht zu erlernen sei, sondern um relativ komplexe Vorgänge, welche unter Verwendung der deutschen Rechtssprache vereinbart worden seien. Nach einem Aufenthalt in Deutschland von maximal eineinhalb Jahren dürfte die Antragstellerin keinesfalls in der Lage gewesen sein, derart fundierte und spezielle Sprachkenntnisse zu erwerben.
Eine Gesamtwürdigung der individuellen Verhältnisse der Ehegatten bei Abschluss des Ehevertrages führe zu dem Ergebnis, dass dieser in einer Gesamtschau seiner Klauseln sittenwidrig sei. Es liege eine evident einseitige und durch die Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte Verteilung der Lasten zwischen den Ehegatten zulasten der Antragstellerin vor.
Bei der Antragstellerin handele es sich um die deutlich unterlegene Verhandlungspartnerin. Infolgedessen sei davon auszugehen, dass der Vertrag nicht dem übereinstimmenden Willen beider Ehegatten entsprochen habe. Vielmehr sei anzunehmen, dass die ehevertraglichen Regelungen Ausfluss der überlegenen Position des Antragsgegners gewesen seien und dieser den Vertragsinhalt weitgehend einseitig bestimmt habe.
Bei der Antragstellerin habe es sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses um die wirtschaftlich unterlegene Vertragspartei gehandelt. Als ausländische Staatsangehörige sei sie damals der deutschen Sprache nicht vollumfänglich mächtig gewesen. Als gebürtige P.in habe sie lediglich über einen anerkannten Schulabschluss, nicht jedoch über eine anerkannte Berufsausbildung verfügt. Bei Vertragsschluss sei sie nicht in ausreichendem Umfang erwerbstätig und daher nicht in der Lage gewesen, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Dass sich diese Situation in Zukunft habe ändern sollen, sei damals nicht absehbar gewesen. Der Antragsgegner sei demgegenüber bereits damals vollständig ausgebildet und erwerbstätig gewesen. Im Gegensatz zur Antragstellerin sei er durchaus in der Lage gewesen, seinen Lebensunterhalt zu sichern und für seine Rente vorzusorgen.
Bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe würden die ehevertraglichen Regelungen in ihrer Gesamtheit als unzumutbar erscheinen, sodass sie durch die Anwendung der gesetzlichen Regelungen zur Durchführung des Versorgungsausgleichs korrigierend auszugleichen seien.
Anders das OLG Hamm:
Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts hält der Ausschluss des Versorgungsausgleichs in Ziff. III. des notariellen Ehevertrags sowohl einer Inhalts- als auch einer Ausübungskontrolle gemäß § 8 Abs. 1 VersAusglG stand.
2. Bei der inhaltlichen Überprüfung von Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich hat der Tatrichter nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zunächst - im Rahmen einer Wirksamkeitskontrolle - zu prüfen, ob die Vereinbarung schon im Zeitpunkt ihres Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihr - und zwar losgelöst von der künftigen Entwicklung der Ehegatten und ihrer Lebensverhältnisse - wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung ganz oder teilweise mit der Folge zu versagen ist, dass an ihre Stelle die gesetzlichen Regelungen treten (§ 138 Abs. 1 BGB ). Erforderlich ist dabei eine Gesamtwürdigung, die auf die individuellen Verhältnisse beim Vertragsschluss abstellt, insbesondere also auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse, den geplanten oder bereits verwirklichten Zuschnitt der Ehe sowie auf die Auswirkungen auf die Ehegatten und auf die Kinder. Subjektiv sind die von den Ehegatten mit der Abrede verfolgten Zwecke sowie die sonstigen Beweggründe zu berücksichtigen, die den begünstigten Ehegatten zu seinem Verlangen nach der ehevertraglichen Gestaltung veranlasst und den benachteiligten Ehegatten bewogen haben, diesem Verlangen zu entsprechen. Das Verdikt der Sittenwidrigkeit wird dabei regelmäßig nur in Betracht kommen, wenn durch den Vertrag Regelungen aus dem Kernbereich des gesetzlichen Scheidungsfolgenrechts ganz oder jedenfalls zu erheblichen Teilen abbedungen werden, ohne dass dieser Nachteil für den anderen Ehegatten durch anderweitige Vorteile gemildert oder durch die besonderen Verhältnisse der Ehegatten, den von ihnen angestrebten oder gelebten Ehetyp oder durch sonstige gewichtige Belange des begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird (BGH Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02 - FamRZ 2004, 601 , 606).
Soweit ein Vertrag danach Bestand hat, muss der Tatrichter sodann - im Rahmen der Ausübungskontrolle - prüfen, ob und inwieweit ein Ehegatte die ihm durch den Vertrag eingeräumte Rechtsmacht missbraucht, wenn er sich im Scheidungsfall gegenüber einer vom anderen Ehegatten begehrten gesetzlichen Scheidungsfolge darauf beruft, dass diese durch den Vertrag wirksam abbedungen sei (§ 242 BGB ). Dafür sind nicht nur die Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgebend. Entscheidend ist vielmehr, ob sich nunmehr - im Zeitpunkt des Scheiterns der Lebensgemeinschaft - aus dem vereinbarten Ausschluss der Scheidungsfolge eine evident einseitige Lastenverteilung ergibt, die hinzunehmen für den belasteten Ehegatten auch bei angemessener Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten und seines Vertrauens in die Geltung der getroffenen Abrede sowie bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe unzumutbar ist. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die tatsächliche einvernehmliche Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse von der ursprünglichen, dem Vertrag zugrundeliegenden Lebensplanung grundlegend abweicht. Nacheheliche Solidarität wird dabei ein Ehegatte regelmäßig nicht einfordern können, wenn er seinerseits die eheliche Solidarität verletzt hat; soweit ein angemessener Ausgleich ehebedingter Nachteile in Rede steht, werden dagegen Verschuldensgesichtspunkte eher zurücktreten. Insgesamt hat sich die gebotene Abwägung an der Rangordnung der Scheidungsfolgen zu orientieren: Je höherrangig die vertraglich ausgeschlossene und nunmehr dennoch geltend gemachte Scheidungsfolge ist, um so schwerwiegender müssen die Gründe sein, die - unter Berücksichtigung des inzwischen einvernehmlich verwirklichten tatsächlichen Ehezuschnitts - für ihren Ausschluss sprechen (BGH Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02 - FamRZ 2004, 601 , 606).
3. Nach diesen Maßgaben verstößt der notarielle Ehevertrag vom 27.09.2002 nicht gegen die guten Sitten im Sinne von § 138 Abs. 1 BGB , sondern ist wirksam.
a) Die gesetzlichen Regelungen über nachehelichen Unterhalt, Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich unterliegen grundsätzlich der vertraglichen Disposition der Ehegatten. Einen unverzichtbaren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten kennt das geltende Recht nicht (BGH Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02 - FamRZ 2004, 601 , 604).
Die grundsätzliche Disponibilität der Scheidungsfolgen darf indes nicht dazu führen, dass der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen durch vertragliche Vereinbarungen beliebig unterlaufen werden kann. Das wäre der Fall, wenn dadurch eine evident einseitige und durch die individuelle Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerechtfertigte Lastenverteilung entstünde, die hinzunehmen für den belasteten Ehegatten - bei angemessener Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten und seines Vertrauens in die Geltung der getroffenen Abrede - bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe unzumutbar erscheint. Die Belastungen des einen Ehegatten werden dabei umso schwerer wiegen und die Belange des anderen Ehegatten umso genauerer Prüfung bedürfen, je unmittelbarer die vertragliche Abbedingung gesetzlicher Regelungen in den Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingreift (BGH Urteil vom 11. Februar 2004 - XII ZR 265/02 - FamRZ 2004, 601 , 605).
b) Zu Recht geht das Amtsgericht nach Maßgabe dieser Rechtsprechung bei Vertragsschluss am 27.09.2002 von einer objektiv einseitigen Lastenverteilung zum Nachteil der Antragstellerin aus, welche nicht durch die individuelle Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse gerechtfertigt, sondern für sie unzumutbar war (objektive Imparität).
(1) Es mag sein, dass der Ausschluss der einzelnen Scheidungsfolgen jeweils für sich genommen den Vorwurf einer Sittenwidrigkeit noch nicht zu begründen vermag. Selbst wenn die ehevertraglichen Einzelregelungen zu den Scheidungsfolgen jeweils für sich genommen den Vorwurf der Sittenwidrigkeit nicht zu rechtfertigen vermögen, kann sich ein Ehevertrag nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Rahmen einer Gesamtwürdigung jedoch als insgesamt sittenwidrig erweisen, wenn das Zusammenwirken aller in dem Vertrag enthaltenen Regelungen erkennbar auf die einseitige Benachteiligung eines Ehegatten abzielt (BGH Beschluss vom 15. März 2017 - XII ZB 109/16 - FamRZ 2017, 2017 , 884 Rn. 38 mwN).
(2) Eine derartige objektive Imparität liegt vor. Die Gesamtschau aller im verfahrensgegenständlichen Ehevertrag enthaltenen Regelungen führt in ihrer Summe erkennbar zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit der Antragstellerin ohne rechtliche Absicherung hinsichtlich Vermögen, Einkommen und Altersvorsorge. In rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sollte die Ehe nach den Vorstellungen des Antragsgegners ein "kompensationsloser Totalverzicht" sein (vgl. BGH Beschluss vom 15. März 2017 - XII ZB 109/16 - FamRZ 2017, 884 Rn. 45). Sämtliche denkbaren Ansprüche der Antragstellerin wurden vollständig ausgeschlossen. Nach Abschnitt IV. sollte selbst Betreuungsunterhalt gemäß § 1570 BGB nicht geschuldet sein. Trennungsunterhalt sollte unter Umgehung des diesbezüglichen Verzichtsverbots nach §§ 1361 Abs. 4 Satz 4, 1360a Abs. 3 , 1614 Abs. 1 BGB wechselseitig nicht geltend gemacht werden. Die Antragstellerin sollte in keiner Weise am Einkommen und Vermögen des Antragsgegners teilhaben. Eine wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Ehegatten wurde ausgeschlossen. Infolgedessen gereichten die von ihnen getroffenen Regelungen in objektiver Hinsicht ausschließlich zum Nachteil der Antragsgegnerin.
c) Da das Gesetz keinen unverzichtbaren Mindestgehalt an Scheidungsfolgen zugunsten des berechtigten Ehegatten kennt, kann aus dem objektiven Zusammenspiel einseitig belastender Regelungen allerdings nur dann auf die weiter erforderliche verwerfliche Gesinnung des begünstigten Ehegatten geschlossen werden, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich in dem unausgewogenen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz eines Ehegatten und damit eine Störung der subjektiven Vertragsparität widerspiegelt (subjektive Imparität). Auch eine lediglich auf die Einseitigkeit der Lastenverteilung gegründete tatsächliche Vermutung für die subjektive Seite der Sittenwidrigkeit lässt sich bei familienrechtlichen Verträgen nicht aufstellen. Ein unausgewogener Vertragsinhalt mag zwar ein gewisses Indiz für eine unterlegene Verhandlungsposition des belasteten Ehegatten sein. Gleichwohl wird das Verdikt der Sittenwidrigkeit in der Regel nicht gerechtfertigt sein, wenn außerhalb der Vertragsurkunde keine verstärkenden Umstände zu erkennen sind, die auf eine subjektive Imparität hindeuten. Hierzu zählen insbesondere die Ausnutzung einer Zwangslage, einer sozialen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit sowie einer intellektuellen Unterlegenheit (vgl. BGH Beschluss vom 15. März 2017 - XII ZB 109/16 - FamRZ 2017, 2017 , 884 Rn. 39 mwN).
d) Entgegen der Auffassung des Amtsgerichts lässt sich vorliegend eine derartige subjektive Imparität nicht feststellen. Die einseitige Lastenverteilung im notariellen Ehevertrag zu Lasten der Antragstellerin beruhte nicht auf einer unterlegenen Verhandlungsposition. Weder befand sie sich in einer Zwangslage, noch trat sie dem Antragsgegner ohne berufliche Ausbildung gegenüber. Erhebliche sprachliche Defizite oder eine allgemeine Unerfahrenheit lassen sich zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls nicht erkennen.
Der Senat hat im vorangegangenen Sorgerechtsverfahren betreffend die gemeinsamen Söhne G. und Y. zum Az. 9 UF 104/22 (= AG Minden 32 F 76/21) anlässlich der persönlichen Anhörungen der Beteiligten in den Terminen am 19.04.2023 und 24.07.2023 einen intensiven und nachhaltigen Eindruck vom Wesen auch der Antragstellerin gewonnen. Sie präsentierte sich als eine intelligente, in Rechtsangelegenheiten außergewöhnlich interessierte, ehrgeizige, durchsetzungsstarke und bestens organisierte Person. Beide Beteiligten verfolgen als Persönlichkeiten ihre Ziele mit ungewöhnlicher Nachhaltigkeit und Beharrlichkeit.
Ihr zielstrebiges und couragiertes Auftreten im Sorgerechtsverfahren legt die Annahme nahe, dass sie notfalls mehrfach nachgefragt hätte, wenn ihr Vertragspassagen unklar geblieben wären.
Es wird nicht übersehen, dass zwischen dem Abschluss des Ehevertrages im September 2002 und den Anhörungen der Antragstellerin durch den Senat im Jahr 2023 mehr als 20 Jahre vergangen sind, in denen sie als Ehefrau, Mutter und Rechnungsprüferin herangereift sein mag. Im September 2002 war sie 25 Jahre alt und in einer ländlichen Region der P. sozialisiert worden. Als sie vor den Senat trat, hatte sie ihr 46. Lebensjahr vollendet und lebte seit 20 Jahren in (..)M.. In der Zwischenzeit mag sie in ihrer Beziehung zum Antragsgegner einen Emanzipationsprozess durchlaufen haben. Prägende Charakterzüge waren indes auch in ihrer Lebensgestaltung ab Sommer 2000 bereits erkennbar. Insbesondere hat die Antragstellerin an keiner Stelle Zweifel an der Eheschließung mit dem Antragsgegner geäußert, welchen sie bei ihrer Heirat im Oktober 2002 seit etwa 2 Jahren kannte. Im Gegenteil war sie fest entschlossen, eine Ehe mit ihm einzugehen und zu diesem Zweck dauerhaft in Deutschland zu verbleiben. Es wird nicht verkannt, dass die Antragstellerin damals noch nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügte und ihre Aufenthaltserlaubnis nach einem einjährigen Aufenthalt als "Au-pair" im Herbst 2002 zu erlöschen drohte. In einer Zwangslage befand sie sich insoweit jedoch nicht. Damals war die Beziehung zwischen den Beteiligten von wechselseitiger Liebe geprägt. Zur Vereinfachung und Beschleunigung ihrer Eheschließung traten sie vor das Standesamt in J. (Z.).
Darüber hinaus kann nicht angenommen werden, die Antragstellerin sei im September 2002 mangels hinreichender Kenntnisse der deutschen Sprache nicht in der Lage gewesen, den Text des notariellen Ehevertrages zu verstehen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen war ihr vielmehr klar, dass sie im Fall einer Ehescheidung vom Antragsgegner nichts zu erwarten habe.
Es mag sein, dass die Antragstellerin vor ihrer Beziehung zum Antragsgegner keine Berührungspunkte mit der deutschen Sprache gehabt hatte und bei dem Erwerb von Deutsch als Zweitsprache bei "Null" begann. Seit ihrem Aufenthalt in F. von März bis Juli 2001 auf Einladung des Antragsgegners belegte sie jedoch konsequent Sprachkurse und arbeitete mit Fleiß und Ehrgeiz an ihren deutschen Sprachfertigkeiten. Noch vor der Unterzeichnung des Ehevertrages im September 2002 hatte sie am 00.07.2002 das "Zertifikat Deutsch" mit der Note "1" bestanden. Es wird nicht übersehen, dass es sich hierbei um die niedrigste Stufe A1 einer fremden Sprache handelte. Bereits 8 Monate nach Abschluss des Ehevertrages absolvierte sie indes im Mai 2003 die "Zentrale Mittelstufenprüfung" des Goethe Instituts mit der Gesamtnote "befriedigend". Das "Zertifikat Deutsch" setzt etwa 600 Unterrichtsstunden voraus. Die "Zentrale Mittelstufenprüfung" wird nach etwa 800 bis 1.000 Unterrichtsstunden abgelegt. Ausweislich einer Beschreibung durch die Goethe Universität E. im Internet (www.(..)) weist der Kandidat dadurch nach, dass er gute Kenntnisse der deutschen Standardsprache besitzt. Diese ermöglichen es ihm, sich zu vielen Themen mündlich und schriftlich weitgehend korrekt zu äußern und auch schwierige Texte zu verstehen.
Seit ihrer erneuten Einreise nach Deutschland im Oktober 2001 lebte die Antragstellerin wieder gemeinsam mit dem Antragsgegner in seiner Wohnung. Während ihrer Tätigkeit als "Aupair" wurde sie durch die ihr anvertrauten Kinder fortlaufend mit der deutschen Sprache konfrontiert. In ihrer Freizeit wurden ihre Sprachfertigkeiten durch den Antragsgegner gefördert. Sein diesbezüglicher Vortrag erscheint angesichts seiner dominanten Persönlichkeitsstruktur, welche im Sorgerechtsverfahren zutage getreten ist, äußerst naheliegend. Zudem besuchte die Antragstellerin weiterhin Sprachkurse. Auf diese Weise ist sie vor Abschluss des notariellen Vertrages im September 2002 ein ganzes Jahr lang von verschiedenen Seiten intensiv mit der deutschen Sprache vertraut gemacht worden. Nach den Ausführungen der Sachverständigen T. im Gutachten vom 01.11.2021 im vorangegangenen Sorgerechtsverfahren vor dem Amtsgericht Minden Az. 32 F 76/21 (= OLG Hamm Az. 9 UF 104/22) hat die Antragstellerin im Rahmen ihrer Begutachtung angegeben, sie sei als "Aupair" nach Deutschland gekommen und habe hier in Deutschland die Sprache "schnell gelernt" (Bl. 8 des Gutachtens vom 01.11.2021).
Bei den Ausführungen des Senats auf den Seiten 12-14 des Hinweisbeschlusses vom 29.07.2024, welche der Antragstellerin nach ihrer Stellungnahme vom 13.08.2024 selbst nach einem 20-jähigen Aufenthalt in Deutschland unverständlich geblieben sein mögen, handelt es sich um erheblich verdichtete Obersätze des Bundesgerichtshofs. Diese beschreiben in verschlungener höchstrichterlicher Fachsprache die abstrakten Prüfungskriterien, stehen jedoch für sich allein noch nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu dem verfahrensgegenständlichen Ehevertrag. In ihren sprachlichen Anforderungen an den Leser gehen sie weit über das Niveau hinaus, welches für das Verständnis des deutlich ausgesprochenen wechselseitigen "Totalverzichts" im Ehevertag vom 27.09.2002 erforderlich war.
Aufgrund der beruflichen Vorbildung der Antragstellerin in der P. erscheint es gleichwohl ausgeschlossen, dass sie den wechselseitigen "Totalverzicht" im notariellen Ehevertrag trotz wiederkehrender Belehrungen des beurkundenden Notars nicht verstanden hatte. Auch wenn der notarielle Vertrag vom 27.09.2002 in deutscher juristischer Fachsprache abgefasst war, stellte sich sein Inhalt eher undifferenziert dar. Denn er beschränkte sich in jeder Hinsicht auf einen Verzicht.
Dem Antragsgegner ist es auch nicht gemäß § 242 BGB nach Treu und Glauben verwehrt, sich auf den Ausschluss des Versorgungsausgleichs zu berufen. Denn er verlässt die Ehe - entgegen der Prognose aus dem Jahr 2002 - mit den wirtschaftlich schwächeren Zukunftsperspektiven. Eine evident einseitige Lastenverteilung zu Lasten der Antragstellerin ergibt sich auf diese Weise aktuell nicht.
Nach dem Verlust seiner gut dotierten Anstellung hat der 54jährige Ehemann noch nicht auf den Arbeitsmarkt zurückgefunden. Inzwischen lebt er von Bürgergeld. Es ist zu befürchten, dass er seine Rentenanwartschaften nicht weiter zu steigern vermag.
Der Ehefrau verbleiben mindestens weitere 20 Jahre im Erwerbsleben, um ihre Rentenanwartschaften zu steigern.
OLG Hamm, Beschluss vom 04.09.2024 - Aktenzeichen 9 UF 105/22




